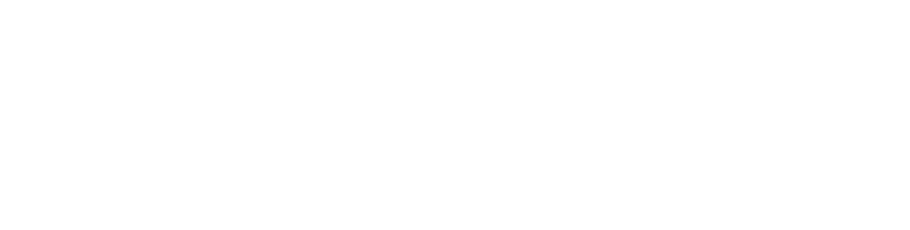Wo Menschen gegen ihren Willen die Freiheit entzogen wird, braucht es auch in der Schweiz eine unabhängige Überprüfung. Davon ist Elisabeth Baumgartner, Vizepräsidentin der «Kommission zur Verhütung von Folter», überzeugt. Obwohl die Situation hier nicht mit derjenigen in anderen Ländern vergleichbar sei und es nicht zu systematischen Folterungen wie Elektroschocks, Peitschenhieben oder Waterboarding komme.
«Im Vordergrund steht in der Schweiz nicht die physische Folter, wie wir sie in anderen Ländern kennen», erklärt die 38-jährige Anwältin. Hauptberuflich arbeitet sie heute für die Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace, zuvor hatte sie als Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Gefängnisse in Kolumbien und Äthiopien besucht.
Recht der Inhaftierten sicherstellen
Baumgartner weiss deshalb, dass unmenschliche Behandlung verschiedene Gesichter haben kann: «In der Schweiz geht es um Fragen wie zum Beispiel: Auf welcher Grundlage darf jemand eine Massnahme über das Strafmass hinaus verlängern? Oder: Gilt eine Verwahrung in Isolationshaft als unmenschlich, wenn die Insassin nur hinter Gitterstäben mit ihrer Therapeutin kommunizieren darf?»
In diesen Tagen veröffentlicht die Kommission ihren ersten Jahresbericht. Mit der Unterzeichnung des Fakultativprotokolls zur UN-Antifolter-Konvention hat sich die Schweiz zur Errichtung einer nationalen Kontrollinstanz verpflichtet. Sie setzt sich aus zwölf Expertinnen und Experten aus Medizin, Psychiatrie, Recht, Polizei und Strafvollzug zusammen. Diese Personen machen in kleinen Delegationen angemeldete und unangemeldete Besuche in Gefängnissen und Anstalten.
«Unsere Aufgabe ist, die Situation von Personen in Freiheitsentzug zu prüfen und mit unseren Besuchen sicherzustellen, dass die Rechte der Inhaftierten eingehalten werden», erklärt Baumgartner. Basierend auf persönlichen Beobachtungen und vertraulichen Gesprächen mit Insassen und Personal, spricht die Kommission Empfehlungen aus.
Budget reicht nicht, um Vorgaben zu erfüllen
Im Frauengefängnis Hindelbank BE kritisierte die Antifolter-Kommission zum Beispiel die rigide Isolationshaft im Hochsicherheitstrakt als «unmenschlich». Im Ausschaffungsgefängnis in Granges VS empfahl sie, die Zweierzellen mit Stehklo durch Einzelzellen mit normalem WC zu ersetzen (siehe Kasten).
Wie weit die Behörden die Empfehlungen der Kommission tatsächlich umsetzen, wird sich zeigen. Seit Juni 2010 haben die zwölf Mitglieder der Kommission 16 Institutionen wie Gefängnisse und Polizeistationen besucht, 7 Ausschaffungsflüge begleitet und darüber Berichte zuhanden von Kantonen und Bund verfasst.
Damit hat die noch junge Kommission die Vorgaben nicht ganz erfüllt: 20 bis 30 Besuche jährlich hat der Bundesrat in seiner Botschaft zur Umsetzung des Fakultativprotokolls zur UN-Antifolter-Konvention ursprünglich vorgesehen. «Mit dem gegenwärtigen Budget von 360 000 Franken können wir diesen Auftrag schlichtweg nicht voll erfüllen», stellt Baumgartner fest. Mit diesem Betrag finanziert die Kommission ein Sekretariat mit 130 Stellenprozenten. Der Zeitaufwand der zwölf Kommissionsmitglieder für die Besuche in den Gefängnissen und Haftanstalten sowie deren Vor- und Nachbereitung wird mit 400 Franken pro Tag und Person entschädigt. Das ist ein sehr tiefer Lohn für qualifizierte Ärzte und Juristen und für die langen Arbeitstage, die oft vom frühen Morgen bis in den Abend dauern. Die Zeit für das Schreiben der Berichte wird dabei nicht einmal in Rechnung gestellt.
Auf der Grundlage des Jahresberichts will die Kommission deshalb formell ein höheres Budget beantragen. Während die Kommission finanziell vom Bund abhängig ist, muss sie gleichzeitig auch Ausschaffungsflüge des Bundesamtes für Migration überwachen und nötigenfalls kritisieren. Das ist keine gute Ausgangslage, um mehr Geld zu bekommen. Baumgartner dazu: «Dieses Problem teilen wir mit anderen eidgenössischen Kommissionen, die eine Kontrollfunktion haben. Wir haben darum schon an alternative Finanzgeber wie zum Beispiel private Stiftungen gedacht.» Konkrete Gespräche hätten aber noch keine stattgefunden.
Die Schweiz ist im europäischen Mittelfeld
Ein Blick über die Landesgrenze zeigt, dass Budget und personelle Besetzung der nationalen Mechanismen zur Umsetzung des Fakultativprotokolls stark variieren: Deutschland zum Beispiel finanziert mit 100 000 Euro jährlich ein Sekretariat (140 Stellenprozent) und beschäftigt einen ehemaligen Richter, Staatsanwalt und Anstaltsleiter als ehrenamtlichen Leiter der Bundesstelle. Der Pensionierte bekommt einzig eine Entschädigung für seine Reisekosten.
In Grossbritannien hingegen arbeiteten bereits bei der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zahlreiche regionale und nationale Kontrolleinheiten. Dieser enorme Apparat von rund zwanzig unabhängigen Organisationen stützt sich bis heute auf zahlreiche Geldquellen und hat ein Budget von mehreren Millionen Pfund.
«Die Ausstattung unserer Kommission entspricht etwa dem europäischen Mittelfeld», schätzt Elisabeth Baumgartner, «wobei unter Justizminister Blocher ursprünglich eine Minimalversion im Sinne von Deutschland vorgesehen war. Erst mit dem Wechsel an der Departementsspitze wurde die Forderung nach mehr Ressourcen erhört.»
Verschiedene Nichtregierungsorganisationen setzten sich damals erfolgreich für ein höheres Budget und mehr Personal ein, darunter Amnesty Schweiz. «Wir sind grundsätzlich damit zufrieden, wie die Kommission heute auf dem Papier ausgestaltet ist», meint Alain Bovard von Amnesty, «Probleme bereitet allerdings die personelle Umsetzung, weil die Erwartungen an die Kommission deren Möglichkeiten übersteigen.»
Zur Entlastung Mandate extern vergeben
Was Bovard damit andeutet: Zeitlich ist es für die Kommission schwierig, die Vorgaben zu erfüllen. Die meisten der zwölf Mitglieder sind hauptberufliche Ärzte, Anwälte und Richter. Es dauert darum oft länger, bis mindestens drei Personen einen gemeinsamen Termin für einen zwei- bis dreitägigen Besuch einer Anstalt finden.
Die Kommission suche darum nach neuen Wegen. «Wir wollen versuchen, künftig punktuell Mandate extern zu vergeben», sagt Baumgartner. «Eine Psychologin soll zum Beispiel in verschiedenen Anstalten den Vollzug von Massnahmen nach Strafgesetzbuch und Verwahrungen in geschlossenen Einrichtungen prüfen.» Eine weitere Herausforderung ist die Frage der Unabhängigkeit: Die Kommission ist aus Experten zusammengesetzt, die im Vollzugsbereich viel Erfahrung mitbringen. Das ist einerseits notwendig, um eine qualifizierte Beurteilung der einzelnen Institutionen abgeben zu können. Gleichzeitig kennen sich aber Überwacher und Überwachte oft persönlich oder arbeiteten gar zusammen.
Die NKVF muss darum vor jedem Besuch die Frage der Unabhängigkeit neu beurteilen. «Es kommt ab und zu vor, dass Kommissionsmitglieder zu bestimmten Inspektionen nicht mitkommen, weil wir allfällige Interessenkonflikte um jeden Preis ausschliessen wollen», bestätigt Baumgartner.
Kommissionsmitglied Alex Pedrazzini, Tessiner Ex-Regierungsrat, hat darum kürzlich demissioniert: «Ich habe vom Kanton Wallis das Mandat bekommen, sein Gefängnissystem zu prüfen, und möchte auch in Zukunft als Berater in Sicherheitsfragen tätig sein. Als Mitglied der Antifolter-Kommission bestand die Gefahr, gleichzeitig Richter und Partei zu sein.»
Das Wichtigste aus den Berichten der Antifolter-Kommission
Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter kritisierte in ihren ersten Berichten nicht nur die beiden besuchten Strafvollzugsanstalten Hindelbank (BE) und Granges (VS). Sie bemängelte auch andere Missstände. So verwiesen Kommissionsmitglieder auf Leibesvisitationen, die bei männlichen Häftlingen im Untersuchungsgefängnis von Brig durchgeführt werden. Hier ist der Hauptkritikpunkt, dass die Visitationen systematisch erfolgen - was die Kommissionsmitglieder als unverhältnismässig bezeichnen. Zudem kritisieren sie die Praxis, Gefangene bei kurzen Transporten im Kanton Wallis - etwa zum Arzt - stets mit Handschellen zu fesseln. Hinzu kommt, dass es keine klare Trennung zwischen Untersuchungs- und Ausschaffungshäftlingen gibt. In Granges empfiehlt die Kommission zudem den Einbau normaler WC (statt Stehtoiletten) sowie das Bereitstellen von Einzelzellen.
In Hindelbank zählen zu den von der Kommission geforderten Massnahmen eine verbesserte medizinische Versorgung der Häftlinge. Die zwölf Kommissions-Mitglieder empfehlen, eine fachpsychiatrische Betreuung zu gewährleisten sowie eine Stelle für Sozialarbeit einzurichten. Zudem gehörten Personen mit schweren geistigen Behinderungen nicht in eine Strafvollzugsanstalt. Die Kommissionsmitglieder betonen freilich, dass es sich dabei um ein landesweites Problem handelt.
Die Kommission hält auch fest, dass die Sprache viele Insassen der Strafanstalten vor Probleme stellt. Die Hausordnung etwa in Granges muss überarbeitet und die verschiedenen Sprachversionen müssen überprüft werden. Schon die deutsche Übersetzung hatten die Kontrolleure als unbrauchbar eingestuft. Ähnliches hatten sie in Hindelbank angemahnt. Besonders wenn Häftlinge diszipliniert würden, müsse gewährleistet sein, dass ihnen die Beschwerdemöglichkeiten in
ihrer Sprache vermittelt würden. Junge Häftlinge sollen ausserdem während des Vollzugs eine Lehre absolvieren können. tk
Fakultativprotokoll zur UN-Antifolter-Konvention
Das Fakultativprotokoll zur UN-Antifolter-Konvention etabliert ein internationales System zur Inspektion von Haftorten zur Verhütung von Folter. Auf internationaler Ebene schafft das Protokoll den «Unterausschuss für Prävention», auf der Ebene der Vertragsstaaten verlangt es «nationale Präventionsmechanismen». In deren Ausgestaltung sind die einzelnen Staaten weitgehend frei. Die Schweiz hat sich nach eingehender Prüfung gegen eine dezentrale Lösung und für die Schaffung der Nationalen Kommission zur Verhütung der Folter (NKVF) entschieden.
Das «Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe» (Antifolter-Konvention) ist am 26. Juni 1987 in Kraft getreten. Die Schweiz ist einer der 146 Staaten, welche die Konvention ratifizierten.