Inhalt
Carl Baudenbacher, 76, Ex-Präsident des Efta-Gerichtshofs in Luxemburg, nimmt nicht gern ein Blatt vor den Mund. Der streitbare Gegner eines bilateralen Vertrags mit Entscheidungskompetenzen für den EU-Gerichtshof schiesst auf Social Media gegen Yves Rossier. Dieser soll als Chefunterhändler der Schweiz 2013 dem damaligen EU-Unterhändler David O’Sullivan «bei Fondue und Weisswein» vorgeschlagen haben, die bilateralen Verträge dem EU-Gerichtshof zu unterstellen, «auf dem Silbertablett und ohne Gegenleistung», so Baudenbacher. Seine Quellen, so der Jurist zu plädoyer: der ehemalige NZZ-Journalist Felix E. Müller und «Nebelspalter»-Autor Dominik Feusi. «Feusi hat Stein und Bein geschworen, dass dies so war.»
Für Rossier ist das «totaler Quatsch». Er und O’Sullivan hätten ein Arbeitspapier mit drei Optionen erarbeitet: Erstens die «Unterstellung der Schweiz unter den Efta-Gerichtshof und die Efta-Aufsichtsbehörde». Zweitens: «Keine Aufsicht über die Schweiz, aber das gemischte Komitee könne zum EU-Gericht gehen.» Und drittens «eine Mischung aus beiden mit einem Schiedsgericht».
Der Bundesrat und der EU-Rat entschieden sich gemäss Rossier für die zweite Variante.» Und Fondue? «Nie mit David O’Sullivan: Als Ire ist er eher der Fleisch- als der Käsetyp.»
Wolfgang Kaleck, 63, Rechtsanwalt in Berlin und Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation ECCHR, schaut gerne über den Tellerrand hinaus. Anfang Juni war er als Sachverständiger zu einer Anhörung über die «Durchsetzung von Menschenrechtskonventionen» im Deutschen Bundestag geladen. Dabei kam er auch auf die Schweiz zu sprechen: Nicht nur notorische Rechtsverletzer wie etwa die Türkei würden sich gegen Entscheide des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sträuben. Auch die Schweiz habe damit Mühe: Die Forderung «Schweizer Recht statt fremde Richter» sei sogar Thema einer Abstimmung geworden. Kaleck wies auch auf den aktuellen Widerstand im Parlament hin, das Klima-Urteil umzusetzen.
Der deutsche Anwalt machte im Bundestag deutlich, dass die Geschichte der Menschenrechte seit 1948 keine «ungebrochene Erfolgsgeschichte» sei. «Staaten, die politische und wirtschaftliche Macht besitzen, halten sich oft nur dann an das Völkerrecht, wenn es ihren eigenen Interessen dient.» Und Menschenrechtsverletzungen würden nur dann angeprangert, wenn sie «im Lager des politischen Gegners» stattfänden.
Patrik Killer, 50, Leitender Jugendanwalt in Zürich, konstatiert einen nachlassenden Respekt von Jugendlichen vor der Staatsgewalt. In der SRF-«Tagesschau» vom 18. Juni sagte er: «Die Jugendlichen sollen begreifen, dass ein Polizist eine Respektsperson ist und auch so behandelt werden muss.»
Wer das nicht kapiert, findet sich in der Kriminalstatistik wieder. Das zeigen die neuen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zur Jugendkriminalität. Das BFS weist seit 2015 eine Zunahme der Verurteilungen von Jugendlichen wegen Hinderung einer Amtshandlung von 200 auf 561 aus. Ob die Jugend tatsächlich weniger Respekt vor der Polizei hat oder ob die Gesetzeshüter vermehrt Anzeige erstatten, will die Jugendstaatsanwaltschaft nicht beantworten. Hauptsache, die Zahlen in der Kriminalstatistik gehen nach oben.
Die Zunahme der Verurteilungen wegen Hinderung einer Amtshandlung erwähnt das Bundesamt im selben Kontext wie die gestiegenen Verurteilungen wegen schwerer Körperverletzung und Raufhandels. Diese Delikte sind aber klar seltener: 2023 wurden insgesamt 170 Jugendliche wegen Raufhandels und 72 wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Und eine Hinderung einer Amtshandlung ist im Unterschied dazu ein Bagatelldelikt.
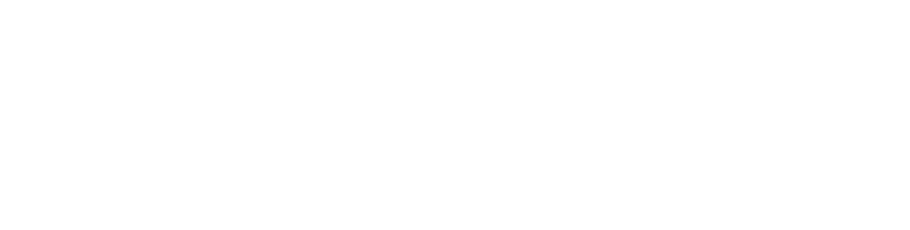
Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Keine Kommentare vorhanden