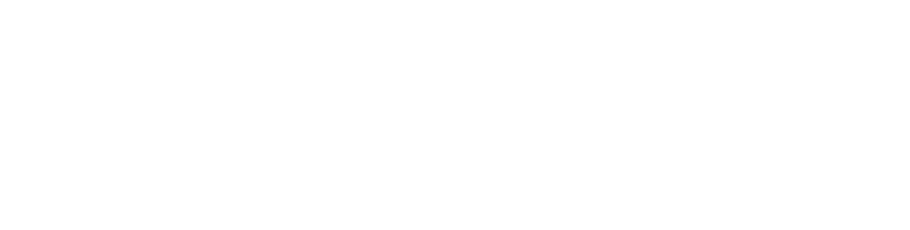plädoyer: Der Berliner Rechtsanwalt und Buchautor Ferdinand von Schirach fordert neue Grundrechte für Europa. Etwa einen Anspruch darauf, dass Äusserungen von Amtspersonen der Wahrheit entsprechen, auf eine gesunde Umwelt oder den Schutz vor Manipulationen im digitalen Bereich. Sollte dieser Vorschlag auch in der Schweiz ernsthaft geprüft werden?
Markus Schefer: Ich sehe den Vorschlag weniger als Versuch, neue Grundrechte zu erfinden, als den schon bestehenden einen aktuellen Gehalt zu geben. Zwar kam es immer wieder vor, dass neue Grundrechte geschaffen wurden – in den 90er-Jahren zum Beispiel das Recht auf Existenzsicherung. Es ist heute in Artikel 12 der Bundesverfassung verankert. Im Zentrum des Vorschlags steht meiner Meinung nach aber die Frage, mit welchen Bedrohungen sich das Individuum heute konfrontiert sieht und wie man die Grundrechte konkretisieren soll, um darauf zu reagieren.
Hans Georg Seiler: Ich frage mich, was «Grundrechte» im Zusammenhang mit diesem Vorschlag eigentlich bedeuten. Ein Recht ist etwas, das man gerichtlich durchsetzen kann. Das ist etwas anderes als eine politische Maxime. Bei einer solchen obliegt es dem Gesetzgeber zu konkretisieren, was etwa eine «gesunde Umwelt» im Sinne von Artikel 1 dieses Vorschlags ist. Handelt es sich aber um einen rechtlichen Anspruch, müssten Gerichte darüber entscheiden, was damit gemeint ist.
plädoyer: Im Zusammenhang mit der Klimafrage sehen sich auch Gerichte zunehmend mit neuen Fragestellungen konfrontiert – zum Beispiel ob «Klimanotstand» ein strafrechtlicher Rechtfertigungsgrund sein kann. Würde es den Richtern helfen, wenn man konkrete Rechte wie ein «Recht auf eine gesunde und geschützte Umwelt» in die Verfassung schreibt?
Seiler: Nein, im Gegenteil. Solche Rechte sind extrem unbestimmt und deshalb konkretisierungsbedürftig. Nehmen wir das Beispiel Atomkraftwerke: Die einen sehen in diesen primär eine Bedrohung für die Umwelt und das Leben, andere erachten sie als notwendig, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Sollen nun Gerichte darüber entscheiden, ob man Atomkraftwerke vom Netz nimmt oder ob man neue bewilligt? Nach meinem Demokratieverständnis ist das eine politische Frage. Es liegt eindeutig am Gesetzgeber, darüber zu entscheiden.
Schefer: Man sollte im Zusammenhang mit Grundrechten nicht immer gleich an Gerichtsentscheide denken. Es ist auf Bundesebene im Wesentlichen der Gesetzgeber, der Grundrechte konkretisiert. Und was Gerichte betrifft, so gilt für sie bei Grundrechten eben nicht das Prinzip «alles oder nichts». Im Deutschland der frühen 80er-Jahre hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit Beschwerden gegen den Bau von Atomkraftwerken auseinanderzusetzen. Es hat sich weder für unzuständig erklärt und sich einfach aus der Affäre gezogen, noch hat es in Frage gestellt, dass Entscheide über den Bau neuer Atomkraftwerke im Kern politische Entscheide sind. Es hat aber festgehalten, dass bei der Bewilligung neuer Atomkraftwerke eine umfassende Risikoabklärung zu erfolgen hat und Risiken so weit als möglich zu minimieren sind. Der Fall zeigt: Gerichte müssen ihre Rolle im Zusammenhang mit solchen Fragestellungen erst einmal finden. Sie können nicht einfach die Funktion des Gesetzgebers übernehmen. Sie sind aber auch nicht irrelevant.
plädoyer: Neben dem Umweltschutz ist auch die digitale Selbstbestimmung ein grosses Thema unserer Zeit. Staaten tun sich schwer damit, die Macht und den Einfluss der grossen Technologiekonzerne in die Schranken zu weisen, und hinken neuen technischen Entwicklungen hinterher. Wären neue Grundrechte in diesem Bereich eine taugliche Antwort auf diese Problematik?
Seiler: Meiner Meinung nach geht es hier einfach um eine Fortführung des bereits in der Verfassung verankerten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Wenn man dieses wirklich so versteht, dass jeder selber bestimmen kann, welche Daten über ihn bearbeitet werden, ist es schon in der heutigen Form kompletter Nonsens. Ein Grossteil der zwischenmenschlichen Kommunikation besteht darin, über andere Leute zu sprechen. Das wäre bei einer strikten Auslegung des informationellen Selbstbestimmungsrechts alles unzulässig. Das kann ja wohl nicht sein. Es muss hier vielmehr darum gehen, per Datenschutzgesetz zu konkretisieren, was mit dem bestehenden Grundrecht gemeint ist.
Schefer: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist kein Nonsens. Aber sein Inhalt ist zu unklar. Neue Grundrechte in diesem Bereich brauchen wir wohl nicht. Aber es stellt sich die Frage, inwieweit bestehende Grundrechte der Konkretisierung bedürfen – vor dem Hintergrund der Gefahren, die es heute im digitalen Bereich gibt. Eine Möglichkeit könnte es sein, das Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre im hinteren Teil der Bundesverfassung zu konkretisieren. Wie man es zum Beispiel mit der Wissenschaftsfreiheit gemacht hat: Im vorderen Teil der Verfassung findet sich in Artikel 20 die Grundbestimmung, in Artikel 118b dann konkretere Ausführungen, wenn es um die «Forschung am Menschen» geht.
Seiler: Es ist eine politische Frage, ob man die Verfassung ändern will. Als ehemaliger Richter kann ich nur sagen, dass ich mich mit präzisen, konkreten Normen stets wohler fühlte als mit schwammigen Gesetzen. Das Entscheiden unter Unbestimmtheit ist nach meinem Richterbild mehr Last als Lust. Es gibt aber auch Richter, die möglichst grosse Gestaltungsfreiheit schätzen und Freude an unbestimmten Normen haben, weil sie so ihre persönlichen Gerechtigkeitsvorstellungen besser durchsetzen können.
Schefer: Ich verstehe das Bedürfnis nach möglichst klaren Normen. Es war aber schon bisher so, dass ein Gericht nicht darum herumkommt, auch in Bereichen tätig zu werden, in denen diese Normen eben nicht vorhanden sind. Das Bundesgericht entwickelte in seiner Geschichte die Grundrechte ja auch immer wieder weiter, ohne dass es sich dabei auf viel Text in der Bundesverfassung stützen konnte. Es anerkannte beispielsweise die Meinungsfreiheit und andere Grundrechte, bevor diese in der Verfassung festgeschrieben waren.
Seiler: Die meisten dieser ungeschriebenen Grundrechte waren bereits in Kantonsverfassungen verankert. Man sollte meiner Meinung nach die vielbeschworene kreative Schöpfung durch das Bundesgericht etwas relativieren.
plädoyer: Bei den grossen Tech-Konzernen handelt es sich um Privatunternehmen, die ihren Hauptsitz meist im Ausland haben. Kommt man mit Grundrechten, die ja primär Abwehrrechte gegenüber dem Staat darstellen, in diesem Zusammenhang überhaupt weiter?
Seiler: Es geht in der Tat um die Frage, wie eine nationale oder regionale Rechtsordnung bei Phänomenen durchgesetzt werden kann, die sich eigentlich ausserhalb dieser Rechtsordnung abspielen. Das Spielbankengesetz regelt beispielsweise, was eine Spielbank darf und was nicht. Wenn ich im Internet nun Spiele chinesischer oder US-amerikanischer Anbieter spiele, stellt sich die Frage, inwieweit diese Spiele Schweizer Recht unterstehen und ob man dieses durchsetzen kann. Von Schirach spricht von europäischen Grundrechten, aber es gibt auch eine Welt ausserhalb Europas.
Schefer: Nur weil es um das Internet geht, sollte man nicht von Anfang an mit dem Reflex reagieren, dass man sowieso nichts machen kann. Die Frage ist vielmehr, auf welche Art und Weise der Staat in diesem Bereich Grundrechte wirksam machen kann. Wie sorgt er dafür, dass Grundrechte auch im Privatverhältnis und bei einem allfälligen internationalen Bezug zum Tragen kommen? Reicht es, eine Internetseite zu sperren? Oder sind Staatsverträge erforderlich? Wenn ja, käme die Politik ins Spiel. Ein umfassender, lückenloser Schutzauftrag besteht nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ein Staat sagen kann «da habe ich nichts damit zu tun» – nur weil es um Private geht, die in einem anderen Land ansässig sind.
plädoyer: Behörden verfügen heute über ein immer grösser werdendes Heer von Medienbeauftragten. Sie selektionieren Informationen und sollen die staatliche Tätigkeit im besten Licht darstellen. Die Wahrheit bleibt häufig auf der Strecke. Von Schirach fordert nun ein Grundrecht, dass Äusserungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Ist dieser Anspruch umsetzbar?
Schefer: Wenn es um Abstimmungen und Wahlen geht, so gelten für Amtsträger bereits heute relativ strenge Anforderungen an die Richtigkeit von Aussagen. Diese hat das Bundesgericht in einer jahrzehntelangen Praxis herausgebildet. Diese Rechtsprechung hat einen Kulturwandel in den Bundesbehörden angestossen. Sie achten heute deutlich besser darauf, dass das, was ins Abstimmungsbüchlein geschrieben wird, auch der Wahrheit entspricht.
Seiler: Ja, das gilt im Rahmen von Abstimmungsbeschwerden. Das Bundesgericht muss allerdings mittlerweile fast schon wieder zurückkrebsen, damit nicht jeder im Zusammenhang mit Abstimmungsinformationen eine Falschbehauptung geltend macht. Auch in anderen Konstellationen müssen die Gerichte prüfen, ob behördliche Angaben richtig sind. Muss man zum Beispiel die Rechtmässigkeit von Covid-Verordnungen beurteilen, stellt sich die Frage, ob die Prognosen – zum Beispiel Todeszahlen –, die der Bundesrat einer Verordnung zugrunde gelegt hat, zutreffend waren. In solchen konkreten Zusammenhängen muss ein Gericht behördliche Entscheidgrundlagen auf ihre Richtigkeit überprüfen können. Aber ich frage mich, was es bringen soll, wenn man jede Äusserung, die ein Amtsträger irgendwo tätigt, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen will.
Schefer: Das sehe ich ähnlich. Würde man die Rechtsprechung zur korrekten Behördeninformation vom Kontext konkreter Urnengänge lösen, hätte das Bundesgericht im öffentlichen Diskurs eine zu starke Stellung. Ich gehe davon aus, dass von Schirach beim «Recht auf Wahrheit» vor allem auch die Präsidentschaft von Donald Trump im Kopf hatte. Man kann sich in der Tat die Frage stellen, mit welchen Mechanismen man groben Falschaussagen von Amtsträgern begegnen will. Aber in der Schweiz ist die Ausgangslage doch eine gänzlich andere – nur schon weil es hier kein Äquivalent zur starken Rolle des US-Präsidenten gibt.
Seiler: Ich habe ganz grundsätzliche Bedenken gegenüber dem Begriff der Wahrheit, der auch wissenschaftstheoretisch höchst umstritten ist. Was wir für die Wahrheit halten, ist nur der jeweils aktuelle Stand des Irrtums. Er kann jederzeit widerlegt werden. Die Idee, wonach eine staatliche Instanz feststellen soll, was wahr ist und was nicht, führt in Richtung Ketzerverfolgung und Scheiterhaufen. Wenn eine staatliche Behörde bestimmt, was als Wahrheit gilt, ist das gefährlicher, als wenn ein Amtsträger ein bisschen lügt.
plädoyer: Grundrechte sollen nach von Schirach von Betroffenen eingeklagt werden können. Diese Frage stellte sich in der Schweiz jüngst im Zusammenhang mit den «Klima-Seniorinnen», die den Bundesrat gerichtlich zu einem aktiveren Handeln in der Klimapolitik verpflichten wollten. Das Bundesgericht wies die Beschwerde mangels Legitimation ab.
Seiler: Es gibt in der Schweiz keine Popularbeschwerde. Eine staatliche Massnahme oder Unterlassung soll nicht von jedem angefochten werden können, sondern nur von jenen, die besonders betroffen sind. Und der Klimawandel ist ein Problem, das grundsätzlich alle gleich betrifft. Wenn nun jeder gegen jede staatliche Handlung oder Unterlassung Beschwerde führen könnte, würde das zu einer Mehrbelastung der Gerichte führen, die kaum jemand begrüssen dürfte.
Schefer: Man sollte auch hier nicht nach dem Schema «alles oder nichts» verfahren. Es soll nicht darum gehen, dass plötzlich alle gegen alles Beschwerde führen können. Aber mit den wichtigen gesellschaftlichen Fragestellungen müssen sich auch die Gerichte befassen. Im Umgang mit dem Klimawandel sollte man nach Wegen suchen, die dem Rechtsschutzbedürfnis Rechnung tragen. Es ist nicht sachgerecht, sich einfach auf den Standpunkt zu stellen, dass das Diskussionen sind, die ein Gericht nichts angehen. Das hat mich am Urteil zu den Klima-Seniorinnen auch gestört: Schutzmassnahmen – zum Beispiel in der Klimafrage – erst dann zu treffen, wenn ein gewisses Intensitätslevel schon erreicht ist, kann nicht die Lösung sein. Wir müssen darüber diskutieren, wie weitgehend das Bundesgericht ein juristischer Akteur mit einer gewissen Machtbefugnis sein soll. Diese Diskussion kann man nicht einfach abklemmen, das Schlagwort «Richterstaat» greift zu kurz. Deutschland hat ein mächtiges Verfassungsgericht, ist deswegen aber noch lange kein Richterstaat.
plädoyer: Wünschen Sie sich ein Bundesgericht mit einer Machtfülle, wie sie der US-amerikanische Supreme Court hat?
Schefer: Die Einflussnahme des Supreme Court auf wichtige gesellschaftliche Fragen ist in gewissen Bereichen als positiv zu beurteilen, in anderen weniger: Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blockierte er die ganze Sozialgesetzgebung. Anderseits war es der Supreme Court, der in den 50er-Jahren der Rassentrennung im Süden ein Ende setzte.
Seiler: Diese Argumentation illustriert schön: Was «positiv» ist und was weniger, ist letztlich eine Frage subjektiver Präferenzen.
Schefer: Die Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weissen, die Tatsache, dass es getrennte Schulen gab – dass das nicht gut war, ist doch keine Frage subjektiver Präferenzen! Da geht es um elementare grund- und menschenrechtliche Fragen. Ich wehre mich dagegen, verfassungsrechtliche Fragen einfach als Fragen individueller Präferenzen abzutun.
Seiler: In der Schweiz ist Rassentrennung kein Thema. Und abgesehen von solchen Fällen, in welchen der Widerspruch einer geschriebenen Norm zum Gerechtigkeitsempfinden ein geradezu unerträgliches Mass annimmt, ist es weitgehend sehr wohl eine Frage des Standpunktes, ob man etwas gut oder schlecht findet. «Gerichte» sind auch nicht homogen, sie diskutieren kontrovers über bestimmte Fragen. Am Supreme Court waren die Richter einst gegen die Sozialgesetzgebung in den USA, ihre Nachfolger hatten dann eine andere Meinung und die Rechtsprechung änderte sich.
Schefer: Trotzdem ist es etwas anderes, wenn ein Gericht über Grund- und Menschenrechte diskutiert, als wenn das im Bundesrat, der Bundesversammlung oder sonst im politischen Diskurs geschieht. Es geht an den Gerichten nicht um tagespolitische Diskussionen, sondern darum, die langjährige Praxis, vergleichbare Fälle oder juristische Kommentierungen zu berücksichtigen. Dabei orientiert sich das Gericht an historisch gewachsenen, breit anerkannten Rechtspositionen. Man müsste sich fragen, wozu es Gerichte überhaupt braucht, wenn man die Unterschiede zwischen einer politischen und juristischen Diskussion negiert.
plädoyer: Soll sich die Rolle des Bundesgerichts ändern, soll es künftig auch als Verfassungsgericht tätig sein?
Schefer: Ich bin der Meinung, dass man diese Diskussion wieder aufnehmen sollte. Aber nicht, indem man einfach den Artikel 190 der Bundesverfassung streicht, der betont, dass Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht noch vor der Verfassung massgebend sind. Auch sollte eine Diskussion über eine Reform der Bundesrechtspflege nicht mit der Frage beginnen, wie man das Bundesgericht entlasten kann. Es geht darum, welche Funktion ein höchstes Gericht in der Staatsorganisation haben soll. Meiner Meinung nach sind wir bislang nicht schlecht gefahren mit der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit. Aber in einigen Fällen hätte das Bundesgericht die Verfassung sicher stärker zum Tragen bringen können. Dass man beispielsweise für Asylbewerber einfach die Unverletzlichkeit der Wohnung abschaffte und eine Hausdurchsuchung ohne konkrete Anhaltspunkte möglich ist – das darf nicht sein. Genau in solchen Fällen sollten Gerichte Schranken setzen.
Seiler: Das Bundesgericht hat im Rahmen der letzten geplanten Revision des Bundesgerichtsgesetzes klar den Standpunkt zum Ausdruck gebracht, dass es falsch belastet ist. Es muss sich unnötigerweise zu oft mit kleinen Fällen auseinandersetzen, die in den unteren Instanzen erledigt werden könnten. Aber die Revision ist nicht zustande gekommen und das Bundesgericht erfüllt den Auftrag, den ihm der Gesetzgeber zugewiesen hat. Und wichtige Rechtsfragen werden trotzdem gründlich behandelt. Man kann diskutieren, ob sich ein höchstes Gericht nicht stärker mit wenigen, wichtigen Fällen befassen soll. Eine andere Frage ist, inwiefern ein solches Gericht dann wie der US-Supreme Court «schöpferisch» tätig sein soll. Nach meinem persönlichen Rechtsverständnis ist dies nicht seine Aufgabe. Ein Gericht soll Lücken füllen, das schon, aber Gesetze zu korrigieren ist meines Erachtens klar die Aufgabe des Gesetzgebers.
Markus Schefer, 56, ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel. Als Mitglied im Uno-Ausschuss für Menschen mit Behinderungen überwacht er die Umsetzung des entsprechenden Vertrages in den Unterzeichnerstaaten.
Hans Georg Seiler, 66, SVP, gehörte von 2005 bis 2021 dem Schweizerischen Bundesgericht an. In seinen letzten sechs Jahren präsidierte er die Zweite öffentlich-rechtliche Abteilung in Lausanne. Per Ende 2021 trat er von seinem Amt zurück.
Vorschlag für neue Grundrechte
Mit der Petition «Jeder Mensch» fordert der Rechtsanwalt und Autor Ferdinand von Schirach folgende neue europäische Grundrechte:
- Artikel 1: Umwelt – Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben.
- Artikel 2: Digitale Selbstbestimmung – Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten.
- Artikel 3: Künstliche Intelligenz – Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen.
- Artikel 4: Wahrheit – Jeder Mensch hat das Recht, dass Äusserungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen.
- Artikel 5: Globalisierung – Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden.
- Artikel 6: Grundrechtsklage – Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den Europäischen Gerichten erheben.
Ziel von Schirachs ist es, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, um politischen Druck auf die EU-Mitgliedstaaten auszuüben. Bis Redaktionsschluss war auf der entsprechenden Website die Zahl von 253 232 Unterschriften aufgeführt.