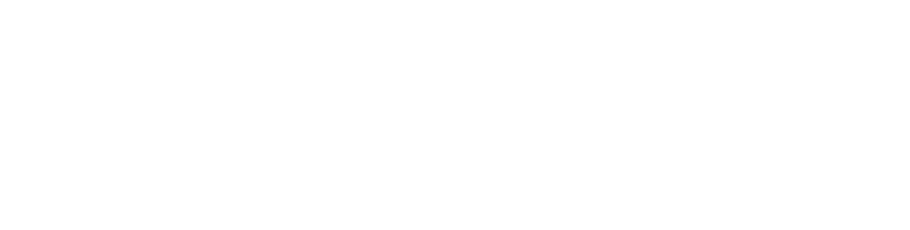1. Keine Änderung seit 1965
Seit Einführung des Stockwerkeigentums in das Zivilgesetzbuch am 1. Januar 1965 sind weit über 50 Jahre vergangen. Materiell sind die Art. 712a bis 712t ZGB so gut wie unverändert geblieben.1 Das Stockwerkeigentum hat sich jedoch sehr stark verbreitet – per Ende 2016 zählte das Bundesamt für Statistik 442 042 selbstbewohnte Wohnungen im Stockwerkeigentum.2
Wenn man nun bedenkt, dass in dieser Aufzählung keine Zweitwohnungen, keine Geschäfts- und Gewerberäume sowie keine vermieteten Stockwerkeigentumswohnungen aufgeführt werden, dann kann man ohne Weiteres von einer Verdoppelung der Zahlen ausgehen.3 Das ist eine bemerkenswerte Stabilität für eine so erfolgreiche Institution des Privatrechts.
In den letzten Jahren haben sich die Lehre und die Politik vermehrt mit dem gesetzgeberischen Handlungsbedarf beim Stockwerkeigentum befasst. Nach über 50 Jahren seit der Einführung ins Zivilgesetzbuch zeigt sich, dass verschiedene Themen beim Stockwerkeigentum die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers verdienen würden. Verschiedene politische Vorstösse und Veröffentlichungen der Lehre äussern sich eingehend de lege ferenda. Wie in den 1950er-Jahren, als es darum ging, das Stockwerkeigentum wieder ins Zivilgesetzbuch aufzunehmen, zeigte sich der Bundesrat anfänglich unbeeindruckt und versuchte zunächst, die Situation quasi «auszusitzen».
2. Politische Vorstösse
Verschiedene Vorstösse wurden dem Parlament in den letzten Jahren unterbreitet. Diese betrafen direkt oder indirekt Stockwerkeigentum. Bei einzelnen Themen bemühten sich Politiker, das Zivilgesetzbuch bzw. das Obligationenrecht auf einen neuen Stand zu bringen. Dabei geht es vor allem um den Anfang des Stockwerkeigentums (Kauf der Wohnung bzw. Mängelhaftung durch den Investor) und um die Vermeidung von dessen vermeintlichem Ende (Ersatzneubau bzw. Gesamtsanierung). Ebenso kann festgestellt werden, dass der Bundesrat in der Regel die Abweisung der Vorstösse beantragte.
Motion Fässler-Osterwalder (Geschäft 09.3392): «Stärkere Rechte der Bauherrschaft bei der Behebung von Baumängeln». Obwohl der Bundesrat eine Ablehnung beantragt hatte, wurde die Motion im Jahr 2011 in beiden Räten angenommen. Inhaltlich geht es darum, Grundstückkäufer – also auch Käufer von Wohnungen ab Plan – im Obligationenrecht besser zu schützen.
Anfrage Chevalley (12.1127): «Stockwerkeigentum und energetische Erneuerung». Eine Änderung des ZGB wurde vom Bundesrat als unnötig erachtet.
Motion Poggia (12.3089): «Werkvertrag bei einem unbeweglichen Werk. Wirksamer Schutz des Bauherrn». Der Bundesrat beantragte die Ablehnung dieser Motion, namentlich weil das Anliegen bereits durch die Motion Fässler-Osterwalder, 09.3392, hinreichend abgedeckt sei. Die Motion wurde vom Nationalrat abgewiesen.4
Motion Leutenegger (12.3168): «Lockerung des Einstimmigkeitsprinzips im Stockwerkeigentumsrecht beim Ersatzneubau». Der Bundesrat beantragte Ablehnung der Motion. Der Nationalrat hat sie angenommen und der Ständerat abgelehnt.5
Interpellation Vogler (13.3552): «Probleme bei der Sanierung von Stockwerkeigentum». Der Bundesrat ortete keinen Revisionsbedarf des Zivilgesetzbuches und die Interpellation wurde nach zwei Jahren unbehandelt abgeschrieben.
Parlamentarische Initiative Gössi (14.453): «Für verbindliche Haftungsregeln beim Kauf neuer Wohnungen». Die Kommissionen des National- und des Ständerates haben diese Initiative behandelt und ihr Folge gegeben bzw. zugestimmt. Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat dieser Initiative am 12. November 2015 Folge gegeben. Am 2. Februar 2016 hat der Ständerat dem zugestimmt. Der Nationalrat hat seinerseits am 15. Dezember 2017 eine Fristverlängerung für die Behandlung des Geschäftes bis in die Wintersession 2021 gewährt.6
Parlamentarische Initiative Hardegger (17.476): «Bauliche Erneuerungen im Stockwerkeigentum. Blockaden verhindern». Dabei solle Art. 712m Abs. 1 Ziff. 5 ZGB wie folgt formuliert werden: «über die Schaffung eines obligatorischen Erneuerungsfonds für Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten, die Höhe der Einlagen und das Reglement zur Verwaltung des Erneuerungsfonds zu befinden». Die Behandlung des Geschäfts steht gegenwärtig noch aus.7
3. Das Postulat Caroni und Feller
Der damalige Nationalrat – und heutige Ständerat – Andrea Caroni reichte im Jahr 2014 ein Postulat mit dem Titel: «Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit für eine Gesamtschau» ein. Anders als die vorgenannten politischen Vorstösse beschränkt sich dieses Postulat also nicht auf einzelne Themen im Stockwerkeigentum, sondern verlangt die Überprüfung des «Gesamtpaketes» (14.3832).
Das Postulat lautet wie folgt: «Per 1. Januar 1965 wurde das Stockwerkeigentum ins ZGB (Art. 712a ff.) aufgenommen. Es prägt die Wohnsituation unzähliger Menschen in der Schweiz und hat sich etabliert. Doch nach fünfzig Jahren ist der Zeitpunkt gekommen, das Stockwerkeigentum einmal auf gesetzgeberischen Anpassungsbedarf zu durchleuchten. Viele Fragen konnten zwar über die Jahrzehnte durch die Rechtsprechung geklärt werden. Andere Themen aber bergen weiterhin Schwierigkeiten und Risiken, die ihrer Lösung harren und die vor fünfzig Jahren noch nicht antizipiert wurden.»
Als Beispiele für mögliche Themen des Berichtes nennt das Postulat folgende Punkte:
«1. Wenn Stockwerkeigentum an einem Baurecht begründet wird (Art. 712d Abs. 2 ZGB), kann das Baurecht in der Regel nur mit Unterschrift aller verlängert werden. Ein einziger Stockwerkeigentümer kann also den Untergang der Gemeinschaft herbeiführen.
2. Oft verweigern Versammlungen die Sanierung, weil kein oder kein genügend dotierter Erneuerungsfonds errichtet wurde. Die Gemeinschaft ihrerseits ist für einen Sanierungskredit nicht kreditfähig.
3. Die Begründung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Gebäudes ist nicht geregelt. Dies führt zu zahlreichen ungelösten Fragen im Verhältnis zwischen Stockwerkeigentümer und Unternehmer/Investor (Wer ist Bauherr? Wer hat Mängelrechte geltend zu machen? Wer kann Änderungen am Bau beschliessen?). Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer möglicher Themen, so die Flexibilisierung der Gebäudeaufteilung, die Möglichkeiten der Gemeinschaft gegenüber Querulanten, die Sicherstellung der Beitragspflicht eines Stockwerkeigentümers, die Vereinfachung der Aktualisierung des Aufteilungsplans usw.
Der Bericht soll diese und allfällige andere Fragen beleuchten und auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf abklopfen. Dort, wo Handlungsbedarf erkannt ist, soll der Bericht auch mögliche Lösungen skizzieren.»
Wenig überraschend beantragte der Bundesrat die Ablehnung des Postulats und antwortete namentlich wie folgt: «… Die Bestimmungen über das Stockwerkeigentum sind zum grösseren Teil nicht zwingendes, sondern dispositives Recht, sie können demnach von den Beteiligten im Stockwerkeigentümerreglement oder durch Beschluss der Stockwerkeigentümergemeinschaft abgeändert werden. Viele Fragen können und müssen von den Stockwerkeigentümern im Stockwerkeigentümerreglement ihren Bedürfnissen entsprechend geregelt werden, zum Beispiel die Beschlussfassung in der Stockwerkeigentümerversammlung, die Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten, die Speisung des Erneuerungsfonds und die Einräumung von Sondernutzungsrechten. Eine sorgfältigere Abfassung dieser Reglemente kann in manchen Fällen späteren Auseinandersetzungen vorbeugen. Wünschbar wäre überdies eine noch gründlichere Orientierung der Käufer über die Vor- und Nachteile von Stockwerkeigentum durch die Notariate, Immobilienmakler und kreditgewährenden Banken. Bei grösseren Stockwerkeigentümergemeinschaften empfiehlt sich die Einsetzung eines fachkundigen Verwalters. Der Umstand, dass eine Regelung 50-jährig wird, ist per se kein Grund für einen Bericht des Bundesrates betreffend eine allfällige Gesetzesrevision. Zudem haben Lehre und Rechtsprechung das Stockwerkeigentumsrecht reichhaltig behandelt. Ein dringender und umfassender legislativer Anpassungsbedarf ist nicht ersichtlich.»
Am 14. September 2016 wurde das Geschäft im Nationalrat beraten. Das Postulat wurde durch Nationalrat Olivier Feller präsentiert, da Andrea Caroni nicht mehr dem Rat angehörte. Nach einer kurzen Präsentation des Postulats legte Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Haltung des Bundesrats dar. Sie beantragte also die Ablehnung des Postulats. Bei der Abstimmung im Nationalrat wurde das Postulat dennoch mit 113 zu 76 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen.8
4. Behandlung des Postulats
Am 8. März 2019 beantwortete der Bundesrat in einem Bericht das Postulat 14.3832 («Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit für eine Gesamtschau»). Abstützend auf ein Gutachten von Bettina Hürlimann-Kaup und Jörg Schmid vom 20. August 2018, welche auf 80 Seiten akkurat die wichtigsten Themen des Stockwerkeigentums aufgreifen und den entsprechenden Handlungsbedarf darstellen,9 führt der Bundesrat was folgt aus: «Angesichts der Schlussfolgerungen im Gutachten und unabhängig von den vorstehenden Ausführungen erkennt der Bundesrat, dass in einigen Bereichen im Stockwerkeigentumsrecht Reformbedarf besteht. Einer entsprechenden politischen Diskussion im Parlament steht er daher offen gegenüber.»
Am 22. März 2019 reichte Andrea Caroni, inzwischen in den Ständerat gewählt, eine Motion mit dem Titel «55 Jahre Stockwerkeigentum – Zeit für ein Update» ein (19.3410). Der Ständerat nahm diese Motion am 4. Juni 2019 an.10 Der Nationalrat sprach sich in der Folge am 12. Dezember 2019 ebenfalls für die Motion aus.11 Ebenso reichte Nationalrat Beat Flach am selben Tag eine Motion ein mit dem Titel «Für ein modernes und praxistaugliches Stockwerkeigentumsrecht» (19.3347). Die Motion von Beat Flach wurde im Nationalrat am 10. September 2019 angenommen.12
Die Behandlung im Ständerat steht bei Redaktionsschluss dieses Beitrags – Mitte Januar 2021 – noch aus. Der Ball liegt also gegenwärtig beim Bundesrat, der dieses Dossier weiterbehandeln muss. Über den Stand der Arbeiten ist dem Schreibenden bisher nichts bekannt.
5. Stellungnahmen aus der Lehre
Zunächst ist die bemerkenswerte Arbeit von Bettina Hürlimann-Kaup und Jörg Schmid vom 20. August 2018 hervorzuheben, deren Gutachten den Bundesrat dazu bewog, seine Opposition zur Modernisierung des Stockwerkeigentums grundsätzlich aufzugeben. Die beiden Autoren haben sich klar zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf bekannt. Sie untersuchten vor allem die besonderen Nutzungsrechte an gemeinschaftlichen Teilen, den Ausschluss eines Stockwerkeigentümers, die Vermutung von Art. 712b Abs. 3 ZGB, die Errichtung des Stockwerkeigentums vor Erstellung des Gebäudes, das Stockwerkeigentum an einem Baurecht, die Untergemeinschaften im Stockwerkeigentum, einen obligatorischen Erneuerungsfonds, die Sicherung der Beitragsforderung, die Geltendmachung von Mängeln an gemeinschaftlichen Teilen durch die Stockwerkeigentümergemeinschaft, die Rechtsmittel der Stockwerkeigentümergemeinschaft gegen querulatorisches Verhalten von einzelnen Eigentümern, die Rechtswirkung des Protokolls der Eigentümerversammlung, die Zweiergemeinschaft und die Aufhebung einer Verwaltungsblockade. Bei den meisten dieser Bereiche erkannten die Verfasser des Gutachtens Handlungsbedarf. Die Auflistung der Themen zeigt: Der Handlungsbedarf geht quer durch die Institution des Stockwerkeigentums.
Andere Autoren haben sich vor allem auf spezifische Einzelthemen konzentriert. Nachfolgend wird kein Gesamtüberblick über alle kritischen Stimmen und Vorschläge gegeben, sondern es werden nur die Autoren genannt, die sich jüngst geäussert haben.
Die erste kritische und kreative Stimme – die heute noch sehr aktiv ist – war wohl jene von David Dürr, der bereits seit Ende des letzten Jahrtausends auf die Systemprobleme hinwies und vorschlug, dass man mit einem «kleinen Wohneigentum» die infrastrukturelle Verantwortung für die gemeinschaftlichen Teile von der Stockwerkeigentümergemeinschaft abkopple und einem Infrastruktureigner übertrage. Der Nutzungswille beim Kauf von Stockwerkeigentum stehe im Widerspruch zur Zwangseinbindung des Stockwerkeigentümers in eine Verwaltungsorganisation.13
Daniela Kohler schlägt namentlich vor, dass das Reglement als Begründungsvoraussetzung für Stockwerkeigentum normiert werden soll.14 In seiner Dissertation schlägt Silvan Wirz vor, einen Art. 712a Abs. 1bis ZGB in das Gesetz einzuführen, welcher den Schutz des Kerngehalts des Sonderrechts zum Zweck hat.15 Kritisch im Bereich der heutigen Situation bei der Unterscheidung zwischen gemeinschaftlichen Teilen und Sonderrecht sowie bei der Fragestellung der baulichen Massnahmen an gemeinschaftlichen Teilen hat sich Markus W. Stadlin geäussert.16 Roland Pfäffli und Michelle Oswald anerkennen ihrerseits die Reformbedürftigkeit des Stockwerkeigentums und einzelner Themen im Postulat Caroni.17 Oliver Martin vertritt die Auffassung, dass Art. 712p ZGB für die zweite Versammlung verbessert werden könnte, indem keine Beschlussfähigkeitsvoraussetzung mehr postuliert würde.18 Nicola Haas sieht einen Handlungsbedarf im Bereich der Umschreibung des Sonderrechts.19 Im Bereich des Aufteilungsplanes ist kürzlich ein bedeutender Beitrag veröffentlicht worden, welcher auch den Handlungsbedarf in der Darstellung und der Rechtswirkung des Instrumentes aufführt und den Planungsstand bei Swisstopo umschreibt.20
Auch der Schreibende hat sich mehrfach zur Revisionsbedürftigkeit des Zivilgesetzbuches geäussert, erstmals im Jahr 2012. Hier seien einige aktuelle Problemzonen des Stockwerkeigentums nochmals kurz erwähnt:21
Begründung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des Gebäudes: Sie erlaubt den Verkauf von Stockwerkanteilen ab Plan – ist aber im ZGB nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Das Gesetz sieht vor, dass Stockwerkeigentum ein Gebäude voraussetzt und der Stockwerkeigentümer zwingend ein Sonderrecht an einem oder mehreren Räumen hat. Viele Fragen und Risiken dieses Begründungsverfahrens harren der Beantwortung. Die heutige Regelung in Art. 69 GBV ist dafür absolut ungenügend.
Verlängerung des Baurechts: Stockwerkeigentum kann an einem selbständigen und dauernden Baurecht begründet werden (Art. 712d Abs. 2 ZGB). Nach Ablauf des Baurechts geht das Stockwerkeigentum automatisch unter. Mit wenigen Ausnahmen (siehe Art. 648 Abs. 2 ZGB) bedarf die Verlängerung des Baurechts der Unterschrift sämtlicher Stockwerkeigentümer. Wenn also eine grössere Gemeinschaft eine Verlängerung des Baurechts anstrebt, um den Untergang des Stockwerkeigentums zu verhindern, könnte allenfalls ein einzelner Stockwerkeigentümer dieses legitime Unterfangen blockieren.
Nachhaltige Finanzierung und die Unterhaltsstrategie: Der Unterhalt und die Erneuerung des Stockwerkeigentumsgebäudes gehören zu den wichtigsten Aufgaben der Stockwerkeigentümergemeinschaft und des Verwalters. Die Bereitstellung der entsprechenden Finanzen ist zentral für die Nachhaltigkeit des Gebäudes. In der Praxis wird oft beklagt, dass Stockwerkeigentümerversammlungen kein Verständnis für eine strategische und systematische Vorgehensweise beim Unterhalt haben und Beschlüsse oft aufgrund der Kostenfolgen verweigern. Um die finanzielle Tragweite solcher Entscheide zu antizipieren und zu entschärfen, können die Stockwerkeigentümer einen Erneuerungsfonds einrichten und äufnen (Art. 712m Abs. 1 Ziff. 5 ZGB). Dieses finanzielle Planungsinstrument ist fakultativ. Eine Untersuchung im Raum Luzern hat ergeben, dass 80 Prozent der Stockwerkeigentümergemeinschaften einen solchen Erneuerungsfonds haben, er in der Regel aber bedenklich unterdotiert ist.
Ersatzneubau: Wird aufgrund des Gebäudezustands einzig ein Erneuerungsbau als mögliche Lösung für den Weiterbestand des Stockwerkeigentums angeschaut, ist in der Regel ein einstimmiger Beschluss für das weitere Vorgehen erforderlich, namentlich weil der Erneuerungsbau mit einer Änderung des Stockwerkeigentums einhergeht. Als einzige Alternative dazu bietet der Gesetzgeber seit dem 1. Januar 2012 die Aufhebungsklage (Art. 712f Abs. 3 lit. 2 ZGB).
Flexibilisierung der Gebäudeaufteilung: Aufgrund der Heterogenität von Stockwerkeigentum müssen unterschiedliche Bedürfnisse abgedeckt werden können. Die starre Aufteilung, die Art. 712b Abs. 2 ZGB heute zwingend vorgibt, vermag den Ansprüchen von kombiniertem oder vertikalem Stockwerkeigentum bzw. von Untergemeinschaften nicht mehr gerecht zu werden.
Rechtsposition des Stockwerkeigentümers: Vielfach empfindet die Praxis, dass ein Stockwerkeigentümer über zu viele Mitwirkungsrechte verfügt. So ist ein Querulant ohne Weiteres in der Lage, die Verwaltung von Stockwerkeigentum während Jahren, manchmal sogar während Jahrzehnten, lahmzulegen.
Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft: Aufgrund von Art. 712 l ZGB verfügt die Stockwerkeigentümergemeinschaft über eine beschränkte Handlungsfähigkeit. Das behindert sie im externen Auftritt. Insbesondere vonseiten der Banken scheint die Kreditfähigkeit und -würdigkeit infrage gestellt.
Die Beitragspflicht des Stockwerkeigentümers: Die wichtigste Pflicht der Stockwerkeigentümer besteht darin, an die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten einen Beitrag zu leisten (Art. 712h ZGB). Dieser Beitrag wird sowohl durch ein Gemeinschaftspfandrecht (Art. 712i ZGB) als auch durch ein Retentionsrecht (Art. 712k ZGB) geschützt. Die Praxis beklagt sich über die umständliche Umsetzung dieser Sicherungsinstrumente und damit über deren Wertlosigkeit.
Problematik des Aufteilungsplans und weiteres Vorgehen: Hier stellen sich zwei Fragen, nämlich jene der Rechtswirkung des Aufteilungsplanes und jene dessen Aktualisierung. Beides ist nicht zur Zufriedenheit gelöst und es kommt nicht von ungefähr, dass hier vonseiten der Lehre und der Verwaltung auch Gedanken angebracht werden.22
6. Handlungsbedarf auch wegen Corona
Die Auflistung in diesem Beitrag ist nicht abschliessend. Aber damit ist erstellt, dass es gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt. Die Politik hat dem Bundesrat denn auch einen entsprechenden Auftrag erteilt. Es bleibt zu wünschen, dass dieser Handlungsbedarf auch in Zeiten der Coronapandemie nicht mangels Priorität auf den Sanktnimmerleinstag verschoben wird. Der Schreibende hat zumindest im Jahr 2020 feststellen müssen, dass der Lockdown, so wie er in der Schweiz praktiziert wurde, zu einer Explosion der Auseinandersetzungen geführt hat. Grund dafür ist auch die Verbesserungswürdigkeit der Rechtslage.
1 Kleine – vor allem formelle – Änderungen haben sich beim Art. 712c Abs. 3 ZGB im Rahmen der Einführung der Zivilprozessordnung auf Bundesebene (in Kraft seit 1.1.2011) sowie beim Art. 712e Abs. 1 ZGB, beim Art. 712f Abs. 3 und 4 sowie beim Art. 712g Abs. 4 ZGB mit der Teilrevision des Sachenrechts (in Kraft seit 1.1.2012) ergeben. Auch Art. 712l Abs. 2 ZGB wurde mit der Gerichtsstandsgesetzgebung, die dann durch die Einführung der Zivilprozessordnung auf Bundesebene wieder aufgehoben wurde, abgeändert (in Kraft seit 1.1.2001).
2 Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Strukturerhebung, Gebäude- und Wohnungsstatistik.
3 Andere gehen von einer Gesamtzahl von Stockwerkanteilen von über einer Million aus. Siehe beispielsweise Andrea Caroni, «Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum: Zeit für eine Gesamtschau», S. 3, in: Amédéo Wermelinger (Hrsg.), Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2015, Luzern 2015.
4 Amtliches Bulletin 2014, N 240 ff. (fortan: AB).
5 AB 2014, S. 879 ff.
6 AB 2017, N 2183.
7 AB 2019, N 25 ff.
8 AB 2016, N 1338 ff.
9 Das Gutachten wurde 2019 veröffentlicht: Jörg Schmid / Bettina Hürlimann-Kaup, Gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Stockwerkeigentumsrecht (Art. 712a–t ZGB), Zürich 2019.
10 AB 2019, S. 288.
11 AB 2019, N 2243.
12 AB 2019, N 1423.
13 Siehe dazu David Dürr, Stockwerkeigentum: «Konzept des Gesetzgebers und Bewährung in der Praxis», in: Regina E. Aebi-Müller / Monika Pfaffinger / Amédéo Wermelinger (Hrsg.), Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011, Bern 2011, S. 6 ff. Für weitere kritische Bemerkungen zur aktuellen Gesetzgebung im Bereich des Stockwerkeigentums siehe David Dürr, «Das Stockwerkeigentum und sein bornierter Gesetzgeber», in: Der Bernische Notar 2016, S. 263 ff.
14 Daniela Kohler, Nachbarrecht im Innenverhältnis der Stockwerkeigentümer, Luzern 2016, N 223 ff.
15 Pascal Wirz, Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum, Zürich 2008, S. 240.
16 Markus W. Stadlin, «Gebäudesanierungen an STWE-Liegenschaften – das Institut des Stockwerkeigentums stösst an seine Grenzen», in: Jusletter vom 4.5.2015, N 20 ff.; bezüglich seiner Meinung zur Wertquotenfestlegung siehe Markus W. Stadlin, «Die Festlegung der Wertquoten (Art. 712e Abs. 1 ZGB): Fragestellungen aus der Praxis», in: Amédéo Wermelinger (Hrsg.), Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2017, Bern 2017, S. 95 ff.
17 Roland Pfäffli / Michelle Oswald, «Reglementarisches Sondernutzungsrecht im Stockwerkeigentum»,
in: Anwaltsrevue 2016, S. 480 f.
18 Oliver Martin, Das Stimmrecht im Wohnungseigentums- und Stockwerkeigentumsrecht, Göttingen 2018, S. 114 f.
19 Nicola Haas, Der Sonderrechtsgegenstand im System des Stockwerkeigentumsrechts, Zürich 2015, N 555 ff.
20 Meinrad Huser, «Der Aufteilungsplan im Stockwerkeigentum: Neue Darstellung – grössere Rechtsverbindlichkeit?» in: ZBGR 2020, S. 205 ff.
21 Siehe namentlich Amédéo Wermelinger, «Das Stockwerkeigentum de lege ferenda», in: Amédéo Wermelinger / Walter Fellmann (Hrsg.), Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2012, Bern 2012, S. 198 ff.
22 Meinrad Huser, a.a.O., S. 205 ff.