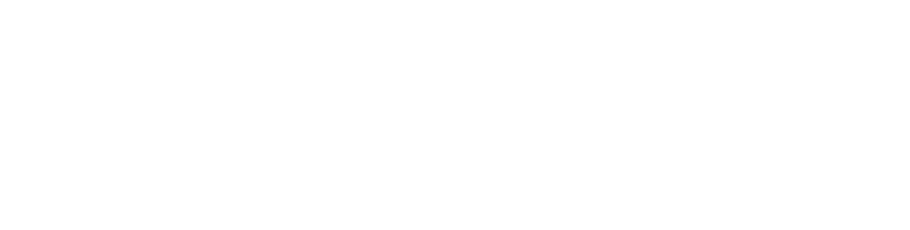Nula Frei, droht der Schweiz bei einem Ja zum Frontex-Referendum das Schengen-Aus?
Inhalt
Plädoyer 02/2022
28.03.2022
Letzte Aktualisierung:
12.10.2022
Nula Frei, Oberassistentin am Institut für Europarecht der Universität Freiburg i.Ue.
Mit dem Schengen-Assoziierungsabkommen (SAA) hat sich die Schweiz gegenüber der EU verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-Acquis zu übernehmen. Die Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Frontex) stellt eine solche Weiterentwicklung dar. Sie löst nur drei Jahre nach der letzten Reform die Verordnung (EU) 2016/1624 als Rechtsgrundlage für die Arbeit von Frontex ab. Frontex soll neu ein stärkeres Mandat er...
Mit dem Schengen-Assoziierungsabkommen (SAA) hat sich die Schweiz gegenüber der EU verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-Acquis zu übernehmen. Die Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Frontex) stellt eine solche Weiterentwicklung dar. Sie löst nur drei Jahre nach der letzten Reform die Verordnung (EU) 2016/1624 als Rechtsgrundlage für die Arbeit von Frontex ab. Frontex soll neu ein stärkeres Mandat erhalten. Insbesondere soll Frontex in Zukunft Exekutivbefugnisse ausüben können, also etwa Personenkontrollen an Grenzen durchführen und Einreisen gestatten oder verweigern dürfen.
Das Referendum richtet sich gegen eine weitere Beteiligung der Schweiz an der Arbeit von Frontex. Akzeptiert die Schweiz die Schengen-Weiterentwicklung nicht, so endet das Schengen-Assoziierungsabkommen gemäss Artikel 7 Absatz 4 SAA automatisch. Es sei denn, der Gemischte Ausschuss, in dem die Schweizer Regierung, der Rat der EU sowie die Kommission sitzen, beschliesst innerhalb von 90 Tagen eine Fortführung der Kooperation. Mit dem Ende des Schengen-Abkommens würde auch das Dublin-Assoziierungsabkommen (DAA) automatisch wegfallen (Artikel 14 Absatz 2 DAA).
Entscheidend wäre also, ob die Schweiz im Gemischten Ausschuss eine Weiterführung trotz Nichtübernahme der Frontex-Verordnung verhandeln kann. Die Schweiz hat noch nie zuvor die Übernahme einer Weiterentwicklung abgelehnt. Deshalb ist eine Prognose über den Ausgang solcher Verhandlungen schwierig. Es ist aber nicht von allzu viel Wohlwollen seitens der EU auszugehen, da die Schweiz die EU kürzlich mit dem Ausstieg aus dem Rahmenabkommen düpiert hat. Aus verhandlungstaktischen Gründen wäre es für die EU kaum möglich, der Schweiz in diesem Dossier substanziell entgegenzukommen.
Dazu kommt, dass die EU beim Thema Grenzkontrollen auch intern unter Druck ist, da dort insbesondere im Asylkontext immer wieder Mitgliedstaaten ausscheren. Es ist somit unwahrscheinlich, dass einem assoziierten Staat ein Alleingang ermöglicht würde. Es ist mangels Präzedenzfällen schwierig einzuschätzen, ob die EU die Sache bis zur Beendigung des Abkommens eskalieren lassen würde. Die EU hat jedoch in anderen Bereichen wie etwa der Forschungszusammenarbeit oder der Börsenäquivalenz bereits gezeigt, dass sie bereit ist, Kooperationen mit der Schweiz zu beenden. Unter Berücksichtigung des politischen Kontexts sind die Chancen für schnelle und erfolgreiche Verhandlungen also eher gering einzuschätzen.
So offenbart das Referendum auch eine der Schwächen des bilateralen Wegs. Die Kritik des Referendumskomitees an der Frontex-Verordnung ist nämlich in vielen Punkten nachvollziehbar. Frontex ist nicht über alle Zweifel erhaben, was den Beitrag zur Militarisierung der Grenzen sowie die (Nicht-)Einhaltung völkerrechtlicher Garantien betrifft. So drohte das EU-Parlament Frontex vor Kurzem wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Push-Backs mit erheblichen Budgetkürzungen. Als Nicht-EU-Mitgliedstaat hat die Schweiz nur begrenzte Möglichkeiten, zu einer völkerrechtskonformeren Ausgestaltung der europäischen Aussengrenzenkontrollen beizutragen, und steht nun vor der Wahl, die Verordnung als Ganzes anzunehmen oder aber den Ausschluss von der Schengen- und Dublin-Zusammenarbeit zu riskieren.